Ab 15. Juli benötigen die 1,1 Milliarden Internet-Nutzer in China einen digitalen Ausweis. Wer online sein will, muss vorher bei der Polizei persönliche Daten hinterlegen und einen Gesichts-Scan abliefern. Es geht um Schutz, komplette Kontrolle und um viel Geld.

Es war natürlich 1984, als Polizeistationen in China damit begannen, nationale Personalausweise für Personen über 16 Jahren auszustellen. Die Bürger benötigen diese Ausweise nach wie vor, um zu reisen, Steuern zu zahlen oder Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen zu erhalten. Nun will die Kommunistische Partei einen weiteren Rubikon überschreiten.
Am 15. Juli wird die Regierung "digitale Ausweise" für die Nutzung im Internet einführen und damit die Verantwortung für die Online-Identitätsprüfung von privaten Unternehmen auf den Staat übertragen.
Dies ist ein potenziell enormer Schritt in der staatlichen Kontrolle über Daten. Er verstärkt Chinas radikal anderen Ansatz bei der Verwaltung und Überwachung des digitalen Lebens seiner Bürger. Und er könnte verändern, wer die Gewinne aus der Online-Wirtschaft einsteckt, und sogar die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in China beeinflussen.
Nach dem neuen System erhalten die Menschen einen digitalen Ausweis, indem sie über eine App eine Reihe persönlicher Daten, darunter auch Gesichts-Scans, an die Polizei übermitteln. Mit diesem Ausweis können sie sich dann bei anderen Apps oder Websites registrieren und anmelden.
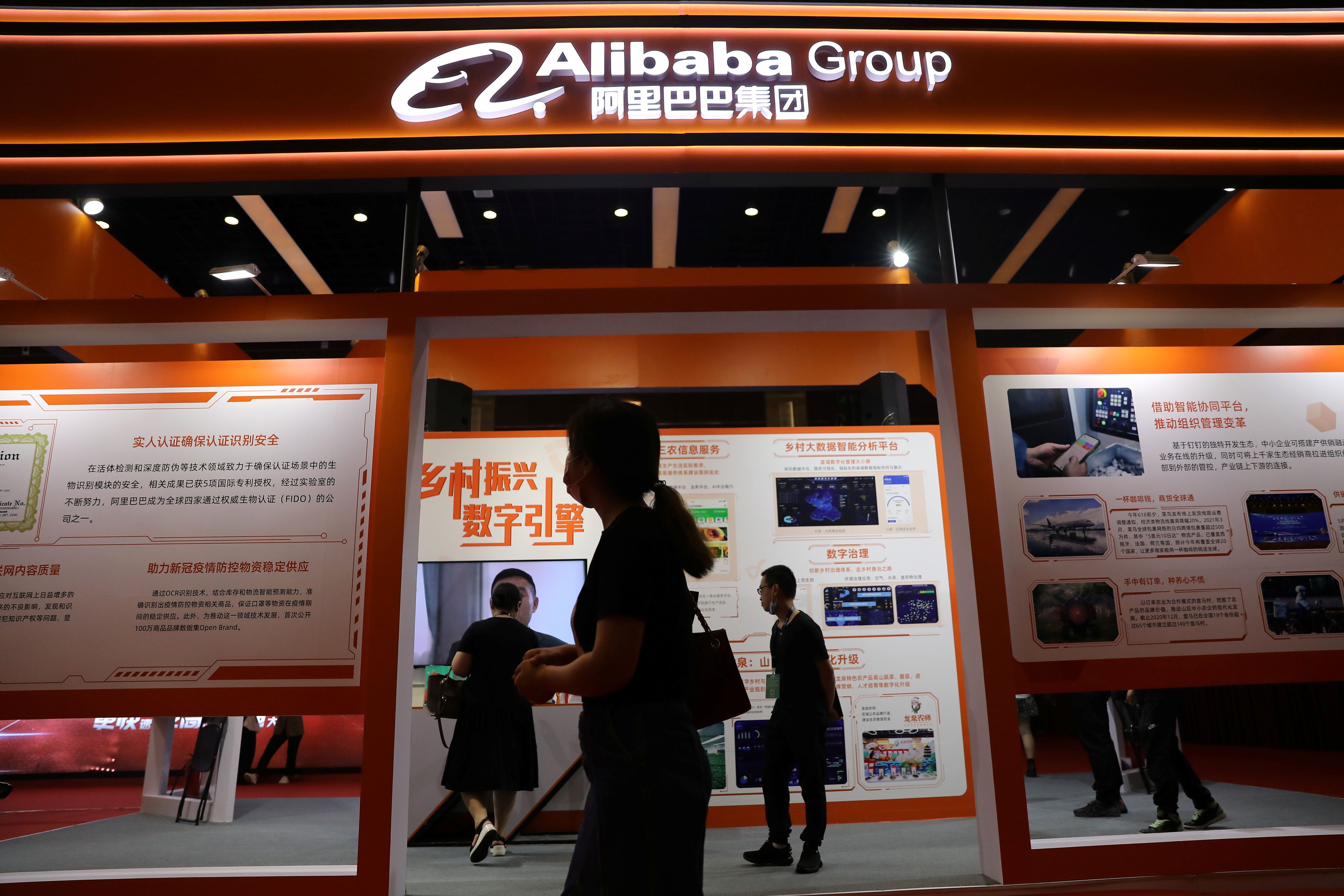
Vor einem Jahr startete ein Pilotprojekt, an dem sich 6 Millionen Menschen angemeldet haben. Derzeit ist die Teilnahme noch freiwillig, aber das dürfte nicht lange so bleiben. Beamte und staatliche Medien drängen die Bürger unter dem Vorwand der "Informationssicherheit" zur Anmeldung.
Im Visier sind die 1,1 Milliarden Internetnutzer Chinas. Rund 1,3 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung sind in den großen chinesischen Internetunternehmen gebunden, die diesen riesigen Kundenstamm bedienen, von Alibaba über Meituan bis hin zu Tencent.
Der Staat versucht bereits, die Geschehnisse im Internet streng zu kontrollieren. Die Regierung unterhält die "große Firewall" durch ihre Kontrolle über die Telekommunikations-Infrastruktur. Sie blockiert Hunderttausende von Websites, darunter ausländische Nachrichtenagenturen, Suchmaschinen und soziale Medien.
Das System ist jedoch vielschichtig und kompliziert. Bevor sie einen Kommentar posten, ein Online-Spiel spielen oder ein Essen bestellen können, müssen sich Chinesen mit ihrem richtigen Namen bei dem Unternehmen registrieren, das den Dienst anbietet. Auf diese Weise lagert der Staat einen Teil der Überwachungsaufgaben aus.
Im vergangenen Jahr gab die Polizei an, 47.000 Menschen bestraft zu haben, die "Gerüchte" verbreitet hatten. Die Unternehmen helfen dabei mit Begeisterung. Weibo, eine X-ähnliche Website der Sina Corp, setzt beispielsweise eine Kombination aus gesperrten Schlüsselwörtern und einer Armee von Zensoren ein, um seine 600 Millionen Nutzer in Schach zu halten.
Die digitale ID ist eine Weiterentwicklung dieses Systems. Unternehmen werden künftig viel weniger über ihre Nutzer wissen. Stattdessen können sich die Menschen mit ihrer ID bei Websites oder Apps anmelden, ohne ihre persönlichen Daten preiszugeben. Die Unternehmen sehen nur einen anonymisierten Strom aus Zahlen und Buchstaben. Internetplattformen können Nutzer weiterhin zensieren und Störenfriede melden – aber nur die Polizei verfügt über die Daten aller Nutzer.

In gewisser Weise ist es überraschend, dass China, ein starker Überwachungsstaat, digitale IDs nicht schon früher eingeführt hat. Dutzende Länder haben bereits eigene Versionen, darunter Australien und Großbritannien, obwohl deren IDs nur für den Zugang zu staatlichen Dienstleistungen verwendet werden und nicht von der Polizei verwaltet werden. Indien begann bereits 2009 mit der Arbeit an seinem viel gepriesenen Aadhaar-Programm.
Warum also macht China das jetzt? Kurzfristig soll das System Schäden für Verbraucher verhindern. Viele Chinesen werden mit Spam-Anrufen überschwemmt, weil ihre persönlichen Daten an Dritte verkauft wurden. Außerdem gelangen viele Daten an Banden von Telekommunikationsbetrügern, deren Betrügereien China jährlich Milliarden Yuan kosten.
"Es ist, als hätte uns die Regierung eine kugelsichere Weste für unsere persönlichen Daten geschickt!", sagte ein begeisterter Journalist der staatlichen Medien in einem Video, in dem er die Menschen zur Anmeldung aufforderte.
Kritiker befürchten, dass die ID die Überwachung verstärken wird. Sie könnte beispielsweise der Polizei helfen, eine Liste aller Websites und Apps zu erstellen, die jede Person nutzt. Diese Informationen könnten sie wahrscheinlich schon jetzt mit ein paar Telefonanrufen erhalten, aber das neue System könnte die Sache vereinfachen.
Die Daten aus den digitalen IDs könnten in Zukunft in ein neues, umfassenderes Online-Überwachungssystem eingespeist werden. Als das System letztes Jahr erstmals angekündigt wurde, löste es im Internet heftige Reaktionen aus. Lao Dongyan, Professorin an der Tsinghua-Universität in Peking, bezeichnete es auf Weibo als "Trick!". Daraufhin wurden ihre Kommentare gelöscht und ihr Konto vorübergehend gesperrt.

Langfristig ist die digitale ID Teil einer weitaus ehrgeizigeren Vision, bei der der Staat eine strengere und zentralere Kontrolle über die riesigen Datenströme der Wirtschaft übernimmt. Dies ist zum Teil durch nationale Sicherheitsbedenken motiviert.
In den falschen Händen – beispielsweise denen ausländischer Spione – könnten personenbezogene Daten für Desinformationskampagnen oder Cyberangriffe missbraucht werden. Sie könnten auch dazu verwendet werden, KI zu trainieren, um Erkenntnisse über die chinesische Bevölkerung zu gewinnen.
Auch wirtschaftliche Chancen stehen hinter dieser Vision. Staatliche Planer bezeichnen Daten neben Arbeit, Kapital und Land als Produktionsfaktor. Sie wollen verhindern, dass Daten in Unternehmen gehortet werden, und sie für eine breite Nutzung und den Handel verfügbar machen.
Lokale Regierungen haben Datenbörsen eingerichtet, um die Monetarisierung und den Handel zwischen staatlichen Stellen, staatlichen Unternehmen und privaten Firmen zu ermöglichen. In Shenzhen, einem Technologiezentrum im Süden Chinas, können Unternehmen beispielsweise Daten darüber kaufen, wie Verbraucher Strom aus dem nationalen Netz verbrauchen.

Eine nationale Datenbörse ist in Planung. Und im Juni kündigte der Staatsrat, Chinas Kabinett, neue Vorschriften an, um die Abschottung von Daten durch konkurrierende Regierungsstellen zu verhindern.
All dies hat Auswirkungen auf die Einnahmen aus Chinas Datenströmen und darauf, wer davon profitiert. Grundsätzlich schadet die digitale ID den Interessen privater Internetplattformen – was der Aktienmarkt jedoch offenbar nicht bemerkt hat.
Die Ruhe täuscht über die Fähigkeiten der Regierung hinweg. In den letzten Jahren ist sie datensammelnde Giganten in anderen Branchen hart angegangen. Im Jahr 2021 wurde die Ant Group, eine Tochtergesellschaft des Technologieriesen Alibaba, gezwungen, ihre Verbraucher-Kreditdaten an die chinesische Zentralbank weiterzugeben.
Im selben Jahr verärgerte das Fahrdienstunternehmen Didi die Regulierungsbehörden, indem es trotz ihrer Bedenken, dass seine Daten offengelegt werden könnten, an der New Yorker Börse notiert wurde. Im Jahr 2022 wurde das Unternehmen mit einer Geldstrafe von 8 Milliarden Yuan (1,2 Milliarden US-Dollar) belegt und wegen "illegaler Sammlung von Millionen von Nutzerinformationen" und der Verarbeitung von Daten in einer Weise, die die „nationale Sicherheit” gefährde, von der Börse genommen.

Zentralisierte Datenflüsse könnten Chinas KI-Initiativen beflügeln. Chinesische Unternehmen dürfen keine in den USA entwickelten KI-Chips kaufen, die zu den leistungsfähigsten der Welt gehören. Sie könnten jedoch weiterhin versuchen, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, indem sie ihre Algorithmen mit mehr und qualitativ hochwertigeren Daten füttern, wie der taiwanesische Tech-Investor Lee Kai-fu argumentiert.
Ein Bereich, in dem riesige Datenmengen chinesischen Unternehmen bereits zu einem Vorsprung verholfen haben, ist die Gesichtserkennungs-Technologie, dank der Millionen von Überwachungskameras, die chinesische Behörden in den Städten installiert haben.
Trotz seines Techno-Optimismus in Bezug auf Daten hat die chinesische Regierung jedoch eine schlechte Bilanz bei deren Verwaltung. Beamte sind oft schlecht bezahlt und suchen nach Möglichkeiten, mehr Geld zu verdienen – beispielsweise durch den Verkauf wertvoller Informationen.

Und die Maßnahmen können lax sein. Im Jahr 2022 stahl ein Hacker 1 Milliarde personenbezogene Datensätze von der Polizei in Shanghai, indem er sie aus einer ungesicherten Datenbank entwendete.
Skandale wie dieser könnten die chinesische Bevölkerung gegenüber Regierungsvorhaben wie digitalen Ausweisen misstrauischer gemacht haben. Glücklicherweise schritten Chinas stets wachsame Tech-Unternehmen ein: Berichte über den Diebstahl wurden zensiert.
"© 2025 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved."
"From The Economist, translated by www.deepl.com, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.com"