Signa, Kika/Leiner, KTM: Fast 7.000 Unternehmen werden heuer Insolvenz anmelden, der höchste Wert seit 20 Jahren. Aber was passiert da hinter den Kulissen? Geld-Expertin Monika Rosen im Interview mit der Anwältin und Insolvenz-Spezialistin Miriam Simsa.

"Ka Geld, ka Musi!" Bei dem Spruch weiß der gelernte Wiener (und nicht nur dieser) sofort, dass es um einen finanziellen Engpass geht. Und geklemmt hat es in der österreichischen Unternehmenslandschaft zuletzt ja ausreichend, von Signa und Kika/Leiner bis KTM.
Laut Hochrechnung des Kreditversicherers Acredia werden heuer 6.950 in die Insolvenz schlittern, ein Plus von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und sehr nahe am Rekord 2005 (da gab es 7.050 Fälle). Besonders betroffen bleiben der Einzelhandel, das Baugewerbe und das Gastgewerbe, zunehmend auch kleinere Betriebe.
Da lohnt es sich schon, ein paar grundsätzliche Fragen zu stellen, wie zum Beispiel: Was ist eigentlich eine Unternehmensinsolvenz? Wann und wie bin ich als Privatperson davon betroffen, sei es als Kunde oder vielleicht sogar als Mitarbeiter? Und – ganz brisant – wie schnell werde ich zum Gläubiger eines Unternehmens, ohne es wirklich zu merken?
Die Finanzexpertin Monika Rosen hat eine ausgewiesene Kennerin der Materie zum Interview gebeten. Miriam Simsa ist Rechtsanwältin und Partnerin in der Kanzlei Schönherr. Sie ist auf Restrukturierungen spezialisiert und spricht über die rechtlichen, aber auch die psychologischen Aspekte des heiklen Prozesses, den wir "Zahlungsunfähigkeit" nennen. Das Interview:
Den Begriff verwenden viele, aber wann sprechen wir tatsächlich von einer Unternehmensinsolvenz?
Ganz simpel: Unternehmen ist insolvent, wenn es Rechnungen nicht mehr rechtzeitig zahlen kann oder überschuldet ist. Der erste dieser beiden Gründe ist meist leichter greifbar als der zweite.

Sehe ich auch so. Unter "Rechnungen nicht mehr zahlen können" kann man sich ja noch was vorstellen, aber was heißt "überschuldet"?
Die Überschuldung kommt meist vor der Zahlungsunfähigkeit. Sie ist schwieriger greifbar, auch für Anwälte. Um festzustellen, ob ein Unternehmen überschuldet ist, bedient man sich meist eines zweifachen Tests.
Wie sieht der aus?
Der erste Teil besagt: Wenn ich das Unternehmen heute zusperre, kann ich dann alle Gläubiger bedienen? Die Bilanz ist dabei nur der Ausgangspunkt, es geht um Fragen, die sich aus der Bilanz nicht erschließen.
Zum Beispiel?
Wie lange dauert es, bis ich aus dem Mietvertrag rauskomme? Was würde es kosten, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu kündigen?
Und der zweite Test?
Das ist die sogenannte "Fortbestehensprognose". De facto geht es dabei um die Planung für die nächsten zwei bis drei Jahre. Dabei wird geschaut, ob das Unternehmen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlungs- und tilgungsfähig bleibt.
Muss das Unternehmen beide Tests bestehen, um nicht als insolvent zu gelten?
Nein, es reicht, einen der beiden Tests zu bestehen. Es geht im Grunde um die Frage: Kann ich mich heute liquidieren, oder zeigt mein Businessplan, dass ich wieder positiv werde? Und ich muss als Unternehmen natürlich Maßnahmen zur Sanierung setzen.

Können Sie da Beispiele nennen?
Das Unternehmen braucht meist Hilfe von außen, zum Beispiel müssen die Banken manchmal auf Forderungen verzichten. Und es muss Maßnahmen im Inneren setzen, zum Beispiel durch Kostensenkungen.
Wie läuft so etwas rechtlich ab?
In Österreich wird eine Restrukturierung meist außergerichtlich aufgesetzt und verhandelt. Angestoßen wird der Prozess oft durch die Banken.
Als Bankerin muss ich da nachhaken: Banken gelten ja oft als "casus belli" bei Insolvenzen …
Ja, allerdings zu Unrecht. Sie haben in dem Prozess oft die Rolle des Buhmanns, sind aber rechtlich zum Einschreiten verpflichtet. Letztlich müssen sie das Unternehmen dazu bringen, den Problemen ins Auge zu schauen. Das gemeinsame Ziel von Unternehmen und Bank ist die Gesundung!
Der Prozess läuft aber meist hinter verschlossenen Türen ab, oder?
Absolut, vor allem die Medien müssen draußen bleiben, damit Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten nicht nervös werden. Wenn Probleme in dieser Phase publik werden, bleiben die Kunden weg und damit wird der Turnaround noch mehr erschwert.
Da geht es sehr stark auch um Vertrauen …
Unbedingt, in dieser Phase ist die persönliche Gesprächsbasis und das Gespür für das Gegenüber äußerst wichtig.

Können Sie da aus Ihrer Erfahrung ein bisschen Einblick geben?
Probleme gibt es häufig bei Familienunternehmen, zum Beispiel mit einem Patriarchen, der gewohnt ist zu befehlen und jetzt plötzlich Anordnungen entgegennehmen muss, zum Beispiel durch eine Bank.
Wie geht das vor sich?
Da stellen sich so scheinbar banale Fragen wie: Wo findet das Gespräch statt, im Unternehmen oder in der Bank? Wie begrüßt man den (zumeist) "alten Herrn"? Oder auch, wen schicke ich als Bank in das Gespräch? Ist das Gegenüber zu jung, wird es ungeachtet aller fachlicher Qualifikation wahrscheinlich Akzeptanzprobleme geben …
Kommen wir zum Timing: Wann muss Insolvenz angemeldet werden?
Hier geht es um die persönliche Haftung der Geschäftsführer. Sie müssen rechtzeitig Insolvenz anmelden. Gläubiger müssen gleich behandelt werden. Nur weil einer lauter schreit, darf er nicht besser gestellt werden. Sonst können wir hier sogar im Strafrecht landen. Dazu gibt es einen markanten Spruch: Zahlen kann noch wer anderer für dich, ins Gefängnis gehen nicht!
Und ab da ist es ein öffentliches Verfahren …
Ja. Man spricht von Edikten, also der gerichtlichen Bekanntmachung von Insolvenzverfahren. Die sind öffentlich einsehbar.
Damit sind wir beim eigentlichen Insolvenzverfahren …
Wenn ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, wird die Geschäftsführung an einen Verwalter abgegeben. Für die Gläubiger bedeutet das eine harte Zäsur.
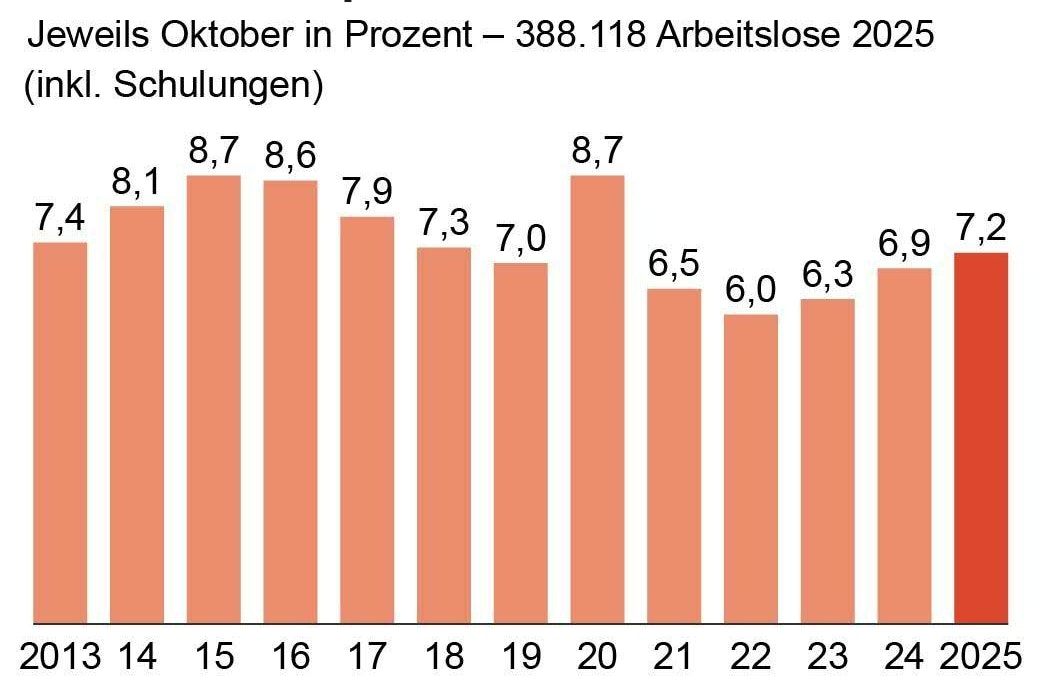
Inwiefern?
Es geht um folgende Frage: Was sind Ansprüche aus der Zeit vor der Insolvenzeröffnung, und was stammt aus der Zeit danach? Dabei ist der Zeitpunkt der Leistungserbringung relevant.
Bitte um ein konkretes Beispiel …
Wenn ich unmittelbar vor dessen Insolvenzeröffnungbeim Versandhandel XY etwas bestelle und bezahle, sprich belastet werde, bin ich ein Gläubiger des Unternehmens. Ich bekomme die bestellte Ware nicht, und von dem Betrag, mit dem meine Kreditkarte belastet wurde, erhalte ich nur die Quote.
Was bedeutet in diesem Zusammenhang der Begriff "Quote"?
Die Quote ist ein Prozentsatz. Dieser sagt aus, welchen Anteil seiner angemeldeten Forderung ein Gläubiger nach Abschluss des Insolvenzverfahrens erhält.
Und was ist mit den Mitarbeitern des Unternehmens im Insolvenzverfahren?
Die Gehälter der Mitarbeiter sind bis zur Insolvenzeröffnung eine Forderung, die auch der Quote unterliegt. Danach werden sie zur Masseforderung und werden voll ausbezahlt.
Mitarbeiter bekommen also auch nur einen Teil ihres Gehaltes?
Nein, die Mitarbeiter sind über den Insolvenzentgeltfonds abgesichert. Von ihm bekommen die Mitarbeiter auch auf Forderungen aus der Zeit vor Insolvenzeröffnung die volle Zahlung.

Und erfolgt da die "Staffelübergabe" vom Unternehmen an den Fonds immer reibungslos?
Naja, das kann mitunter etwas dauern und dann zu Härtefällen führen. Vor allem dann, wenn die Insolvenz kurz vor der Auszahlung des 13. oder 14. Bezuges erfolgt und der Mitarbeiter mit diesem Geld gerechnet hat.
Und was muss der Masseverwalter vor allem sofort leisten?
Er muss entscheiden, ob das Unternehmen fortgeführt werden kann, und das innerhalb weniger Tage. Wird fortgeführt, dann übernimmt der Masseverwalter die Verantwortung für das Unternehmen – von der Würstelbude bis zur Chemiefabrik.
Kommen wir zum letzten Teil: Wie schnell werde ich als Privatperson zum Gläubiger?
Ich werde immer dann zum Gläubiger, wenn ich zahle oder eine Leistung erbringe (etwa als Mitarbeiter) und die Gegenleistung (Ware, Dienstleistung oder auch Gehalt) noch nicht da ist.
Bitte wieder um Beispiele!
Jede online Bestellung, die ich sofort bezahle, fällt da hinein. Ebenso wenn ich eine Anzahlung leiste, für Waren oder auch Urlaubsreisen. Jeder Gutschein ist eine Vorleistung desjenigen, der den Gutschein gekauft hat.
Im Urlaub ist eine Insolvenz des Reiseveranstalters besonders bitter …
Natürlich, aber Anbieter von Pauschalreisen müssen gegen eine Insolvenz versichert sein. Und ganz wichtig: die Urlauber müssen zurückgeholt werden!
Kann ich mich als Verbraucher da schützen?
Wie erwähnt, sind Anbieter von Pauschalreisen gegen Insolvenz versichert. Auch Kreditkarten oder Zahlungssysteme wie Paypal können eine Absicherung bieten. Es lohnt sich auf alle Fälle, das vor einer größeren Anzahlung zu checken.

Wir wollen niemand an den Pranger stellen, aber können Sie zu den genannten Punkten ein paar konkrete Beispiele aus Österreich nennen?
Die Anzahlungen wurden zum großen Thema bei Kika/Leiner. Die Mitarbeitergehälter haben besonders bei der Insolvenz von KTM für Schlagzeilen gesorgt.
Und was ist mit Signa?
Da waren Privatpersonen weniger betroffen, da kaum Verbraucher geschädigt wurden. Aber es zeigt ein anderes Phänomen …
Nämlich?
Ein sehr komplexes Firmengeflecht, wie es bei Signa vorliegt, macht die Rettung schwierig. Signa erwies sich als nicht krisenresistent. Die Konstruktion war zu komplex und zu sehr abhängig von tiefen Zinsen und steigenden Immobilienpreisen. Und von beidem mussten wir uns ja verabschieden. Außerdem hat ein Immobilienunternehmen einen prinzipiellen Nachteil.
Und zwar?
Wie der Name schon sagt, geht es dabei um Immobilien, also um unbewegliche Dinge. Ein produzierendes Unternehmen wie KTM könnte eventuell auch was anderes herstellen als Motorräder oder die Produktion verlagern. Bei Immobilien gibt es de facto keine Alternativen. Da kann ich nur warten, bis sich die Preise erholen.
Monika Rosen war mehr als 20 Jahre bei einer heimischen Großbank tätig, ist Vizepräsidentin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft und gefragte Spezialistin rund um alle Geldthemen